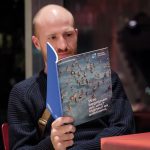- Publikationen
- November 2025
Studienvorstellung: Wer wollen wir als Gesellschaft sein?

Was bedeutet es heute, über deutsche Identität zu sprechen? Bei unserem Launch der neuen Studie „Deutsche Identität(en)? Wer wir als Gesellschaft sein wollen“ im Publix zeigte sich schnell: Es geht nicht nur um Befunde – sondern um die vielen offenen Fragen, die Menschen in Deutschland derzeit bewegen. Fragen nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Gestaltung und dem Miteinander in einer Gesellschaft im Wandel.
Moderiert von unserer Leitung Partnerschaften Inga Gertmann und nach einem Impulsvortrag von unserem Forschungsleiter Jérémie Gagné, diskutierten Christin Bohmann (Chefredakteurin MDR), Dr. Juliane Rapp-Lücke (Referatsleiterin Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, Bundeskanzleramt) und Milad Tabesch (Gründer „Ruhrpott für Europa“) über Selbstbilder, Zugehörigkeit und die demokratische Verantwortung, diese Aushandlung aktiv zu gestalten.
Wie schwer es fällt, über „Deutschland“ zu sprechen
Unsere Forschung zeigt: Vielen Menschen fällt es schwer, gelassen über „Deutschland“ zu sprechen. Jérémie Gagné berichtete, wie im Forschungsgespräch zunächst ein Raum für Austausch darüber zu schaffen war, wofür dieses Land stehen soll.
Und doch steckt hinter dieser Zurückhaltung ein hoher Anspruch: Viele wünschen sich, dass Deutschland ein Land ist, das für Ausgleich, Verlässlichkeit und Qualität respektiert wird. Kein dominantes Land, sondern ein starkes.

Foto: More in Common / Paul Alexander Probst
Zugehörigkeit und Ausgrenzung – eine Frage, die viele beschäftigt
Aus der Perspektive von Milad Tabesch, Gründer von „Ruhrpott für Europa“ wurde deutlich, wie unterschiedlich Zugehörigkeit in Deutschland erlebt wird und wie sehr diese Frage junge Menschen beschäftigt. In seiner Arbeit mit Jugendlichen im Ruhrgebiet zeigt sich immer wieder, wie ambivalent das Verhältnis zu nationaler Identität sein kann.
Unsere Daten zeigen: 72 Prozent finden, dass Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft grundsätzlich als erwerbbar gesehen wird, auch wenn man nicht in Deutschland geboren wurde. Aber 28 Prozent schließen diese Möglichkeit aus. Für viele junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist das ein schmerzhaft klares Signal. Und Milads Erfahrungen in Workshops zeigen: Regionale Identitäten sind oft stärker als das nationale Wir-Gefühl. Identität ist eben nie nur eine Ebene, sondern ein Geflecht aus Herkunft, Region, Biografie und Alltag.

Foto: More in Common / Paul Alexander Probst
Engagement dort, wo Deutschland ganz konkret wird
Juliane Rapp-Lücke brachte als Leiterin des Referats Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement im Bundeskanzleramt die Perspektive aus der Politik ein. Sie sieht parallel zwei Bewegungen: Gerade im Ehrenamt zeigt sich, was Gesellschaft zusammenhalten kann: Nachbarschaftshilfe, spontane Initiativen, lokale Projekte. Sie sprach aber auch klar an, wo es hängt: Bürokratie, Haftungsfragen, Förderstrukturen. Der geplante „Zukunftspakt für das Ehrenamt“ soll hier ansetzen.
Übersetzung zwischen Politik, Gesellschaft und Medien
Ein weiteres großes Thema des Abends war Vertrauen. Milad Tabesch betonte, dass es Menschen und Organisationen braucht, die zwischen Politik und unterschiedlichen Communities vermitteln: verständlich, nahbar, auf Augenhöhe. Sein Projekt „Ruhrpott für Europa“ setzt dafür auf Schulen, lokale Begegnungsformate und direkten Dialog mit der politischen Ebene.
Christin Bohmann, Chefredakteurin des MDR, sprach darüber, wie sich auch öffentlich-rechtlicher Journalismus weiterentwickelt: durch mehr lokale Präsenz, neue Dialogformate und einen konstruktiveren Ansatz, der Orientierung bietet, ohne Debatten zu verengen. Für Redaktionen wie für die Medienkultur insgesamt ist das eine anspruchsvolle, aber notwendige Aufgabe.

Foto: More in Common / Paul Alexander Probst
Keine große Erzählung sondern viele geteilte Geschichten
Einig war sich das Panel darin: Es braucht nicht eine nationale Erzählung. Was es braucht, sind verbindende Ambitionen für unser Gemeinwesen und vielfältige Geschichten, die nebeneinanderstehen können: Diese Vielfalt ist ein demokratischer Schatz. Doch sie ist angreifbar, wenn demokratische Akteure das Feld von Identität und Stolz anderen Kräften überlassen.
Was wir mitnehmen
Aus dem Abend lassen sich einige gemeinsame Aufgaben herauslesen:
- Mehr Räume für Begegnung, lokal verankert und niedrigschwellig.
- Vernetzung jenseits von Projekten, zwischen ehrenamtlichen Initiativen, Medien und Verwaltung.
- Eine zugewandtere Debattenkultur, die Konflikte aushält, ohne Menschen abzuschreiben.
- Jungen Menschen echte Bühne geben, nicht nur Beteiligungsversprechen.
- Hoffnung und Solidarität ernst nehmen, nicht als Gefühl, sondern als erlebbares Angebot.
- An starken Zukunftsbildern als demokratisches Angebot für diese Gesellschaft mitbauen
Wir danken allen, die den Launchabend mit Leben gefüllt haben und freuen uns darauf, diese Debatte gemeinsam weiterzuführen.
Fotos: (c) More in Common / Paul Alexander Probst
Zur Studie: Deutsche Identität(en)? Wer wir als Gesellschaft sein wollen